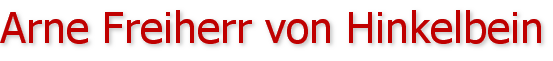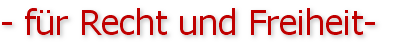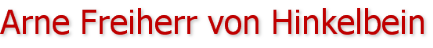Unterschriftsleistung
Neuheiten
Im Rechtsverkehr ist stets der ausgeschriebene Vor (Name) - u. Zuname (Familienname) zu verwenden! Das nicht Vorhandensein einer Unterschrift der verantwortlichen Person unter einem per Post zugestellten Schriftstückes verstößt gegen die Rechtsnorm, daß Entscheidungen, Anordnungen, Willenserklärungen o.ä. zur Erlangung ihrer Rechtswirksamkeit grundsätzlich einer eigenhändigen Namensunterschrift des Ausstellers bedürfen und infolge Ermangelung der durch Gesetz vorgeschriebenen Form nichtig ist (vergl. §§ 275 StPO, 37 VwVfG, 315 ZPO, 125 und 126 BGB und Art. 50 bis 53 EGBGB). Die Nichtigkeit ist auf Antrag festzustellen. (§ 44 BVwVfG)
Geschäftsordnung für die Finanzämter (FAGO)
3.4.5 Elektronische Signatur, Unterschrift, Beglaubigung
- (1) Schreiben, die elektronisch versendet werden, sind mit elektronischer Signatur zu versehen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schreiben in Papierform sind grundsätzlich zu unterschreiben. Bei einer Unterschrift ist der Name der/des abschließend Zeichnenden lesbar unter die Unterschrift zu setzen.
Es unterschreibt die/der Zeichnungsberechtigte. Bei zu unterschreibenden Reinschriften soll in der Regel kein Dienstsiegel angebracht werden.
- – Schreiben, bei denen nach Art oder Inhalt eine Unterschrift geboten ist;
- – Urkunden, Verträgen und sonstigen Schreiben, die zu ihrer rechtlichen Wirksamkeit der Unterschrift bedürfen;
- – Schreiben auf Grund des Geschäftsgangsvermerks „zU“.
Beglaubigt wird, indem der Name derer/dessen, die/der die Verfügung abschließend gezeichnet hat, unter das Schreiben gesetzt und hinzugefügt wird:
Beglaubigt
Unterschrift
Anstelle des Wortes „Beglaubigt“ ist das Wort „Bestätigt“ zu verwenden.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bei der Zustellung eines Schriftstückes, gleich welcher Art an die beteiligten Parteien, gehört grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift des Verfassers. (vgl. z.B. Urteil vom 6. Dezember 1988 - BVerwG 9 C 40.87 - BVerwGE 81, 32, <33>).
Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muß die erlassende Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten. Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form verwendet, muß auch das der Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen [§ 37 BVwVfG].
"Die Unterschrift unter ein Schreiben ist eine Wirksamkeitserfordernis" BGH vom 09.12.2010 (IX ZB 60/10)
Die Unterschrift der für das Schriftstück verantwortlichen Person ist in Gegenwart eines/r Urkundsbeamten/in (ein/e Justizangestellte/er kann keine Urkundsbeamter/in sein, da Beglaubigungen nur von Beamtinnen und Beamte, die eine spezielle Ausbildung erhalten haben, vorgenommen werden dürfen (§ 153 GVG)) zu leisten, die sich von der Rechtmäßigkeit der Person vergewissert hat mit Ort und den Tag der Beglaubigung, sowie mit Unterschrift des für die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und dem Dienstsiegel (mit Nummer) zu versehen [§ 129 BGB]. Das Dienstsiegel darf dabei nicht verletzt (Überschrieben) sein, da es sich ansonsten um einen s.g. Siegelbruch (§ 136 StGB) handelt (vergl. VwvfG § 34).
Amtliche Beglaubigen können stets nur siegelführende Behörden, weil das Dienstsiegel nach § 33 Abs. 3 Nr. 4 VwVfG zur Rechtswirksamkeit einer amtlichen Beglaubigung erforderlich ist. Ohne Siegel ist eine amtliche Beglaubigung nichtig.
Das Gesetz knüpft an das Erfordernis der Unterschriftsbeglaubigung eine wesentliche Rechtsfolge. Mangelt es an der vorgeschriebenen Beglaubigung, sind Urteile und Entscheidungen wegen Formmangels nichtig, entfalten also von Anfang an keinerlei Rechtswirkungen. Ist das bloße Handzeichen unter einer schriftformbedürftigen Entscheidung wie ein Urteil, ein Beschluß oder ein Strafbefehl nicht amtlich beglaubigt, so ist die zugrunde liegende Entscheidung wegen Formmangels ebenfalls nichtig (§ 125, § 126 BGB und Art. 50 bis 53 EGBGB). Eine Heilungsmöglichkeit, wie sie teilweise bei Schriftform- und Beurkundungsmängeln besteht, ist für fehlende Beglaubigungen nicht vorgesehen
Das nicht Vorhandensein einer Unterschrift der dafür verantwortlichen Person unter einem per Post zugestellten Schriftstückes oder eines sonstigen Dokuments verstößt gegen die Rechtsnorm, daß Entscheidungen, Anordnungen, Willenserklärungen o.ä. zur Erlangung ihrer Rechtswirksamkeit grundsätzlich einer eigenhändigen Namensunterschrift des Ausstellers bedürfen und bei Ermangelung der durch Gesetz vorgeschriebenen Form nichtig (vergl. §§ 275 StPO, 37 VwVfG, 315 ZPO, 125 und § 126 BGB und § 34 VwVfG). Eine Anordnung, ein Beschluß, ein Urteil wie auch Verträge jeglicher Art müssen zur Rechtskrafterlangung unterschrieben sein, weil nur die Unterschrift seine Herkunft verbürgt. (§ 129 Rn 8 ff BGH VersR S 6, 442, Karlsr. Fam . RZ 99, 452). Bei einem Verstoß, einem an BRdvD-Gerichten nicht auszurottenden Übel, liegt rechtlich nur ein Entwurf (eine Kladde) vor. (Üb 12 vor § 300, BGH NJR 80. 1167, Karlsr. Fam. RZ 99, 452) Es setzt keine Notfrist in Lauf (BGH NJW 95, 933) auch keinerlei andere Frist. Dann hilft auch kein Nichtabhilfebeschluß auf Beschwerde. (Karlsr. Fam RZ 99, 452)
"Unterschriften von Richtern müssen stets mit dem Namen oder zumindest so wiedergegeben werden, daß über ihre Identität kein Zweifel aufkommen kann. Denn für den Zustellempfänger muß - zur Erlangung der nach dem GG gebotenen Rechtssicherheit - nachprüfbar sein, ob die Richter, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, das Urteil auch unterschrieben haben. Deshalb genügt die Angabe "gez. - Unterschrift -" nicht."
Eine beschuldigte PERSON mit einem öffentlich- rechtlichen Namen gilt als unschuldig, bis sie durch ein rechtskräftiges Urteil eines ordentlichen Gerichts für schuldig befunden wurde. [vgl. Art. 20 Hess.Verfassung] Ein rechtskräftiges Urteil setzt den Eintritt formeller Rechtskraft voraus. Aus den Gerichtsakten läßt sich entnehmen, daß die Urteile (Urschrift) und sonstige Entscheidungen rechtskräftig seien, doch die Rechtskraft wird von den mangelnden Formerfordernissen der §§ 275 StPO, 37 VwVfG, 315 ZPO, 126 i.V.m. 34 VwVfG und 129 BGB durchbrochen unter denen die Urschriften der Entscheidungen leiden, was zur Folge hat, daß diese und alle weiteren darauf aufbauenden Rechtshandlungen nichtig sind.
Der Rechtsbefehl des § 125 BGB regelt in einer solchen Sache unmißverständlich und nicht auslegbar: "Ein Rechtsgeschäft welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge"
Hiermit zwingt das Gesetz den Rechtsverkehr zur Beachtung der Formvorschriften, weil ansonsten die Verträge oder Rechtshandlungen nicht oder nur teilweise gültig sind. Diese harte Konsequenz ist notwendig, da sonst die Formvorschriften wertlos würden. Die Nichtigkeit ist absolut und von Gerichten von Amts wegen zu beachten. Dort, wo vom Gesetz Formvorschriften vorgesehen sind, muß die Nichtigkeit nicht mehr besonders erwähnt werden, denn sie ist durch § 125 BGB generell per Rechtsbefehl angeordnet.
Das Fehlen jedweder Unterschrift der erkennenden und entscheidenden Richter ist dem völligen Fehlen der Urteilsgründe gleichzustellen, d.h. es fehlt das Zeugnis, daß es sich bei den schriftlich niedergelegten Gründen um die Gründe des Gerichts handelt, die als Ergebnis der Hauptverhandlung in der Beratung gewonnen wurden. Die Verantwortung wird durch die eigenständige Unterschrift übernommen. Sodann soll mit dem Legalisierungsvermerk und Dienstsiegel die unterschreibende Person nach außen legitimiert werden, weshalb ein Dienstsiegel diesen Zweck nur übernehmen kann, wenn es individualisiert ist, z.B. durch eine entsprechende Nummerierung. Ein generell aufgedrucktes Dienstsiegel wird einer solchen Individualisierung nicht gerecht und erfüllt in Ermangelung der Erklärung sowie fehlender Unterschrift, Beglaubigungsvermer und Dienstsiegel die übrigen Voraussetzungen für eine Vollstreckung nicht.
[so auch BGH, Urteil vom 25.10.2007, Az: I ZB 19/07, zitiert nach Juris; Sozialgericht Düsseldorf, Urteil vom 21.12.2011, Az. S 14 KA 74/10; LG Wuppertal, Beschluss vom 25.03.2011, Az. 6 T 238/10, m.w.N.). [OLG München 26.06.2018 – 5 OLG 15 Ss 89/18 (Rn. 7)].
Die Nichtentscheidung ist ein nullum und kann keine Rechtswirkung haben. Sie bindet das Gericht nicht, beendet die Instanz nicht … erzeugt keinerlei Kosten.
Scheinurteile sind keine Urteile und daher keinem Rechtsmittel unterworfen …hierhin gehören … Entscheidungen mit schwersten und offenkundigen Mängeln, ferner nicht verkündete Urteile. Das Scheinurteil ist grundsätzlich nichtig.
Die Ausfertigung eines Urteils ( auch Beschlusses) muß erkennen lassen , daß das Original die Unterschriften der Richter trägt. Allein die Angabe "gez. Unterschrift" oder Angabe der Namen im Kopf des Urteils genügen hierfür nicht, desgleichen nicht Angabe der Namen der Richter nur in Klammern ohne weiteren Hinweis darauf, daß sie das Urteil unterschrieben haben. Ohne mindestens den Zusatz "gez." ist auch überhaupt keine Beglaubigung möglich. Eine Ausfertigung hingegen soll gerade bestätigen, daß die Urschrift mit einer gesetzeskonformen Unterschrift mit durch Vor- und Nachnamen einer Person identifizierbar zuzuordnend gezeichnet wurde, ohne Akteneinsicht nehmen zu müssen. Die fehlerhafte Beglaubigung wird hier durch substantiiertes Vorbringen nach § 418 I mit Abbildung der Mängel und gegebenenfalls Vorlage der Urkunden nachgewiesen, falls nach § 139 ZPO dieses noch notwendig ist und angefordert wird. [vergl.ZÖLLER, Rn 14]
Urkundsbeamte, die Scheinurteile beurkunden, verhalten sich im hohen Maße rechtswidrig. Denn sie beurkunden Urteile, die die Anforderungen des § 315 ZPO nicht erfüllen. Scheinurteile seitens der Urkundsbeamten zu beurkunden und mit einem Gerichtssiegel zu versehen, kommt der arglistigen Täuschung gleich; wird einem doch vorgegaukelt, daß es sich um Urteile i.S.d. der Zivilprozessordnung handelt. Das gleiche gilt bei Beurkundungen von sogenannten Ausfertigungen von angeblichen Urteilen.
Abschriften oder Ausfertigungen sind den Prozeßparteien nur auf Antrag einer Partei zuzusenden (vergl. § 37 StPO i.V.m. § 317 (2) ZPO) und dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn das Urteil verkündet, unterschrieben und den Prozeßparteien ordnungsgemäß zugestellt wurde (vergl. § 37 StPO i.V.m. § 317 (1) und (2) ZPO). Solange eine Entscheidung oder das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben und nicht zugestellt ist, dürfen von ihm Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden.
Abschriften oder Ausfertigungen sind den Prozeßparteien nur auf Antrag einer Partei zuzusenden (vergl. § 37 StPO i.V.m. § 317 (2) ZPO) und dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn das Urteil verkündet, unterschrieben und den Prozeßparteien ordnungsgemäß zugestellt wurde (vergl. § 37 StPO i.V.m. § 317 (1) und (2) ZPO). Solange eine Entscheidung oder das Urteil nicht verkündet und nicht unterschrieben und nicht zugestellt ist, dürfen von ihm Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften nicht erteilt werden.
Die Ausfertigung besteht in einer Abschrift der Urschrift, die mit dem Ausfertigungsvermerk versehen ist. Sie soll in der Überschrift als Ausfertigung bezeichnet sein und auf der Urschrift soll vermerkt werden, wem und an welchem Tage eine Ausfertigung erteilt worden ist (vergl. BurkG § 49 1 und 2)
Der Ausfertigungsvermerk soll den Tag und den Ort der Erteilung angeben, die Person bezeichnen, der die Ausfertigung erteilt wird, und die Übereinstimmung der Ausfertigung mit der Urschrift bestätigen. Er muß mit vollen Namen unterschrieben sein wobei (h) "Gekritzel und unverständliche Zeichnungen" verboten sind (Zensurbestimmungen).
Haftung und Schadenersatz
Die Zusendung von Angeboten die Namen wie Bescheid, Mahnung, Zahlungserinnerung, Ordnungswidrigkeit, Strafbefehl, Urteil oder ähnliches haben, die nicht unterschrieben und daher wirkungslos sind, keine Rechtsfolgen auslösen können, damit null und nichtig sind, auch alles was danach erfolgte ebenso null und nichtig ist und an die Adresse des Menschen gerichtet sind, damit der Mensch als Organ der juristischen PERSON handelt in dem irrigen glauben, er sei die PERSON und der Name, ist als geschäftsmäßiger Betrug anzusehen, denn der Mensch wird auf diese Art genötigt, für den ihm angedichteten Namen und die PERSON, die Eigentum des Staates sind, zu handeln, was ihm von gesetzlicher Seite verboten ist. Das ist Anstiftung zu einer Straftat [vgl. § 26 StGB] sowie Nötigung und Erpressung [Die Anstiftung ist neben der Beihilfe § 27 StGB eine Form der Teilnahme an einer Straftat].
Geschieht dies dauerhaft und unter Vorsatz, so ist das als Folter anzusehen, denn der BUND versucht auf diese Art der Einschüchterung und Maßregelung, den Menschen, der keiner Jurisdiktion des BUNDES/Staates unterliegt, zu unterwerfen, ihn zu brechen und seine Menschlichkeit zu zerstören, ihn zu einem Leibeigenen des Staates/BUNDES zu erziehen und ihn seiner Körperlichkeit zu berauben. Geschieht die dauerhaft, so erzeugen diese menschenverachtenden Maßnahmen akute körperliche Schmerzen, physische Störungen. Eine systemische Aktivität mit einem rationalen Zweck. Dauerhafte rechtswidrige Verwaltungsforderungen- Vollstreckungen greifen die Psyche und/ oder auch den Körper des Opfers an (Angst, Streß, Selbstmordgedanken, Verlust des Lebenswillens, kornische Schlafstörungen) und führen zu, mitunter dauerhafte Schädigungen oder zerstören den Menschen gänzlich. Man bezeichnet dies als "weiße Folter". Verwaltungsangestellte, Bedienstete, Richter und andere Dienstpersonen bedienen sich dieser Mittel, denn Menschen sollen gezwungen werden, die Rechte und Pflichten der bundeseigenen PERSONEN (Geburtsurkunde) annehmen und sich der "staatlichen" Jurisdiktion unterwerfen.
Wird ein Mensch über eine längere Zeit vorsätzlich mit Strafe, mit Handlungen gegen Leib und Leben oder gegen Freiheit bedroht, ist dies mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre zu bestrafen [§ 107b StGB AT]. Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens des verletzten Menschen herstellt oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung des verletzten Menschen bewirkt [§ 107b (3) StGB AT]. Und wer Menschen als Leibeigene behandelt oder sonst einem anderen Menschen in Form von Sklaverei oder einer sklavereiähnlichen Lage die persönliche Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen.
"Die Zeit, in der hierarische Ordnungsstrukturen ihren Dienst tun,. das System , in dem Menschen sich bereitwillig als Objekte zur Verfügung stellen, ist vorbei. (Prof. Hüther in "Mann sein")
Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. [vgl. § 36 BeamtStG].
Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen und fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag [§§ 826, 830 und 839 BGB].
Neben der Strafe ist auch ein Schadenersatz (§§ 826, 830 und 839 BGB) an das Opfer zu leisten. Das Opfer kann selbst die Höhe des zu leistenden Schadenersatzes bestimmen, da das Opfer, der Mensch, keinem Diktat eines Staates unterliegt. Als widerrechtlich ist jeder Verwaltungsakt einer "Behörde" gegen einen Menschen anzusehen, denn in der Regel verfügt die "Behörde" über keine Legitimation, um ihre Pflichten und Rechte auf einen Menschen zu übertragen (Übernahme von Leistungspflichten der PERSON der Geburtsurkunde im Eigentum des BUNDES- eine gewillkürte Stellvertretung [Art. 8 BGBEG]).
Das gilt auch für den Fall, wenn mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht haben, oder wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat (vgl. §§ 826, 830 und 839 BGB).
Sind Sie sicher, daß Sie einen Verwaltungsakt, der in Ermangelung der durch Gesetz vorgeschriebenen Form (fehlende rechtswirksame Unterschriften) nichtig ist, wirklich durchsetzen wollen?
Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen (" Überleitungsvertrag ")(in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung) Amtlicher Text, BGBL. 1955 11 S. 405.
Artikel 2 (1) "Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen derBesatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben injeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderenRechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nachinnerstaatlichem deutschem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen."
Vertreten wird die Militärregierung in Deutschland durch die Botschafter der drei West-Alliierten, Vereinigte Königreich Großbritannien, die Vereinigten Staaten von America und die Republik Frankreich sowie Rußlands.
Die Militärregierung kann hoheitliche Aufgaben an eine Verwaltung (Verein/BUND) übertragen, wie etwadas „Vereinigte Wirtschaftsgebiet“ (Art. 133 GG), doch dafür bedarf es einer Aktivlegitimierung. OhneAktivlegitimierung keine hoheitliche Handlungsbefugnis. Das bedeutet, daß jede Person die in Deutschland glaubt Hoheitliche Aufgaben zu verrichten, über eine Alliierte-Kontrollratsnummer verfügen muß.
Außer Kraft gesetzt waren die Militärregierungsgesetze zu keiner Zeit nur nach BUNDesrecht für die Verwaltung außer Wirkung gesetzt, um freier agieren zu können. Auch eine Form von Täuschung.
Daher gilt:
Militärregierung - DEUTSCHLAND KONTROLLGEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS
I5. UNTERSCHRIFT
Alle Mitteilungen persönlicher oder geschäftlichen Art müssen mit dem vollen Namen des Absenders unterschrieben sein. Der Name des Unterzeichners einer geschäftlichen: Mitteilung muß deutlich, mit der Schreibmaschine oder in lateinischer Druckschrift geschrieben, unter der Unterschrift erscheinen.
16. Verboten sind:
(h) Gekritzel und unverständliche Zeichnungen;
Militärregierung - DEUTSCHLAND KONTROLLGEBIET DES OBERSTEN BEFEHLSHABERS
Zensurbestimmungen
Alle Mitteilungen persönlicher oder geschäftlichen Art müssen mit dem vollen Namen des Absenders unterschrieben sein. Der Name des Unterzeichners einer geschäftlichen: Mitteilung muß deutlich, mit der Schreibmaschine oder in lateinischer Druckschrift geschrieben, unter der Unterschrift erscheinen.
16. Verboten sind:
(h) Gekritzel und unverständliche Zeichnungen;
7. Strafen
Jede vollendete oder versuchte Umgehung oder Verletzung dieser Vorschriften setzt den Missetäter der Verfolgung durch den Gerichtshof der Milzitärregierung aus und unterwirft ihn der Strafe die das Gericht auferlegen mag.
In Hessen ist jeder Bedienstete und Beamte aufgrund seiner Eidesleistung auf die "Hessische Verfassung" an die Zensurbestimmungen gebunden, denn ihr Wortlaut regelt unmißverständlich: [HessVerf. Art. 159 - Der vom Kontrollrat für Deutschland und von der Militärregierung für ihre Anordnungen nach Völker und Kriegsrecht beanspruchte Vorrang vor dieser Verfassung, den verfassungsmäßig erlassenen Gesetzen und sonstigem deutschen Recht bleibt unberührt.],
Und im Art. 2 Abs. 1 des Überleitungsvertrages heißt es: "Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach innerstaatlichem deutschem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen."
So ist es Aufgabe der Militärregierung (SHAEF) sich um Gesetzesbrecher zu kümmern.
Deutschland ist seit dem Jahr 1918 zu keinem Zeitpunkt souverän gewesen und immerzu von Alliierten Mächten besetzt. Diese haben Mandatsregierungen mit dem Auftrag installiert, um das besetze Land sozusagen als Kolonie zu verwalten. Die Besatzungsmächte führten als Verwaltungsgebiete Länder ein (Proklamation Nr. 1), die Namentlich denen der Gebietskörperschaften der Bundesstaaten des Deutschen Reiches ähneln, um, ganz offensichtlich, die Bevölkerung über ihren Rechtsstatus zu täuschen. Die Verwaltungsgebiete der BRD sind territorial nicht identisch mit den Gebietskörperschaften/Bundesstaaten des Deutschen Reiches.
Die Verwaltung "Bundesrepublik in Deutschland" verwaltet damit Teile des Deutschen Reiches treuhänderisch im Auftrag der Besatzungsmächte und die Menschen, die "freiwillig" als Staatenlose gemäß Übereinkommen über die Rechtstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954, BGBl. 1976 II S. 474 Artikel 27 einen Personalausweis beantragen und damit ihre ihnen zustehenden Grund- / Rechte auf die Treuhandgesellschaft übertragen, nicht wissend, daß sie durch diesen Verwaltungsakt ihre bürgerlichen Rechte sowie die Grundrechte aufgeben. Als "Staatenlose" gelten dabei alle Personen, die keinen Antrag auf Feststellung der Staatsangehörigkeit gestellt habe bzw. die als "Holschuld" keinen Staatsangehörigkeitsausweis besitzen.
Verwaltungen können keine Gesetze erlassen oder beschließen. Daher gelten in Deutschland bis zur Wiederherstellung der Souveränität ausschließlich folgende Gesetze:
BGB, SHAEF-Gesetze, HGB und HLKO
Alle Unterschriftleistungen haben daher nach den MRG-Zensurbestimmungen und § 126 BGB zu erfolgen.
Deutschland ist seit dem Jahr 1918 zu keinem Zeitpunkt souverän gewesen und immerzu von Alliierten Mächten besetzt. Diese haben Mandatsregierungen mit dem Auftrag installiert, um das besetze Land sozusagen als Kolonie zu verwalten. Die Besatzungsmächte führten als Verwaltungsgebiete Länder ein (Proklamation Nr. 1), die Namentlich denen der Gebietskörperschaften der Bundesstaaten des Deutschen Reiches ähneln, um, ganz offensichtlich, die Bevölkerung über ihren Rechtsstatus zu täuschen. Die Verwaltungsgebiete der BRD sind territorial nicht identisch mit den Gebietskörperschaften/Bundesstaaten des Deutschen Reiches.
Die Verwaltung "Bundesrepublik in Deutschland" verwaltet damit Teile des Deutschen Reiches treuhänderisch im Auftrag der Besatzungsmächte und die Menschen, die "freiwillig" als Staatenlose gemäß Übereinkommen über die Rechtstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954, BGBl. 1976 II S. 474 Artikel 27 einen Personalausweis beantragen und damit ihre ihnen zustehenden Grund- / Rechte auf die Treuhandgesellschaft übertragen, nicht wissend, daß sie durch diesen Verwaltungsakt ihre bürgerlichen Rechte sowie die Grundrechte aufgeben. Als "Staatenlose" gelten dabei alle Personen, die keinen Antrag auf Feststellung der Staatsangehörigkeit gestellt habe bzw. die als "Holschuld" keinen Staatsangehörigkeitsausweis besitzen.
Verwaltungen können keine Gesetze erlassen oder beschließen. Daher gelten in Deutschland bis zur Wiederherstellung der Souveränität ausschließlich folgende Gesetze:
BGB, SHAEF-Gesetze, HGB und HLKO
Alle Unterschriftleistungen haben daher nach den MRG-Zensurbestimmungen und § 126 BGB zu erfolgen.
Beglaubigte Abschrift
Bei einer "beglaubigten Abschrift" handelt es sich um eine Fotokopie der Urschrift in der Akte. Der Urkundsbeamte bestätigt mit seiner Unterschrift und dem Dienstsiegel die Übereinstimmung der Fotokopie mit der Urschrift. Mangelt es der "beglaubigten Abschrift" an einer Unterschrift des Hautverantwortlichen auf der Urschrift, so mangelt es auch der Urschrift an einer rechtswirksamen Unterschrift, denn die Fotokopie stimmt mit der Urschrift der Akte überein. Wird eine "beglaubigte Abschrift" (Fotokopie) anstelle einer Urschrift einem nicht anwesenden einer Verhandlung zugestellt, so mangelt es an einer rechtswirksamen Willenserklärung (Urteilsverkündung), da "beglaubigte Abschriften" (Fotokopien) erst erstellt werden dürfen, wenn die Willenserklärung (Urteilsverkündung) bereits erfolgt ist. Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. (vgl. § 130 BGB). Folglich gilt eine Willenserklärung (Urteilsverkündung), die durch eine "beglaubigte Abschrift" mitgeteilt wird, als nicht verkündet, ist rechtlich nur ein Entwurf, kann keine Fristen erzeugen, erzeugt keine Rechtsfolgen.
Urteilszustellung
Wird eine Entscheidung, ein Urteil oder eine sonstige Willenserklärung einem nicht anwesenden gegenüber mitgeteilt, so ist diese erst wirksam, wenn die Formvorschriften der §§ 126 bis 129 BGB erfüllt sind und zugestellt wurde [vgl. 130 BGB]. Der Verkündungstermin ist der Zustellungszeitpunkt. Erst danach dürfen von der Entscheidung, einem Urteil oder eine sonstige Willenserklärung Abschriften, Auszüge und Ausfertigungen gefertigt werden.
Geht einer abwesenden Partei lediglich eine Abschrift oder eine Ausfertigung einer Willenserklärung zu ohne daß diese zuvor formgerecht als Urschrift zugestellt wurde, so mangelt es dieser Willenserklärung an einer formellen Verkündung die daher keine Wirkung, Fristen und sonstige Rechtskraft entfalten kann, denn die Formvorschrift des § 130 BGB wurde verletzt. Die Zustellung einer Abschrift oder einer Ausfertigung, ähnlich der Übermittlung eines Dokumentes zur Fristenwahrung per Telefax, erfüllt nicht eine Entscheidungs- oder Urteilsverkündung gegenüber abwesenden gemäß § 130 BGB weil es an dem formgerechten Zugang der Willenserklärung mangelt. [OLG München 26.06.2018 – 5 OLG 15 Ss 89/18 (Rn. 7)] Auch die durch das Signaturgesetz eingeführte „digitale Signatur“ erfüllt nicht das Erfordernis der „eigenhändigen Unterschrift“.
Pflichtverteidiger
Die Verkündung eines Urteils in Gegenwart eines Pflichtverteidiger ohne Anwesenheit des Angeklagten oder die Zustellung einer Entscheidung, ein Urteil oder einer sonstigen Willenserklärung an einen "Pflichtverteidiger", der über keine schriftliche Vollmacht des Angeklagten verfügt, ist unwirksam [vgl OLG Hamm, Beschluss v. 03.04.2014, 5 RVs 11/14]. Die besondere Vertretungsvollmacht des Verteidigers des Angeklagten ergibt sich auch nicht per se aus der Pflichtverteidigerbestellung. „Der Pflichtverteidiger hat grundsätzlich dieselbe Rechtsstellung wie der gewählte Verteidiger. Er ist aber nicht der (allgemeine) Vertreter, sondern Beistand des Angeklagten, der einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen hat. Dies bedeutet, dass der Pflichtverteidiger – ebenso wie der Wahlverteidiger – einer (gegebenenfalls erneut erteilten) ausdrücklichen Vertretungsvollmacht bedarf. Die Zustellung an die nicht prozessfähige Person ist unwirksam. [vgl. § 170 ZPO]
Eröffnungsbeschluß
Eine Klage, ein Eröffnungsbeschluß und sonstige Beschlüsse und Urteile einer Staatsanwaltschaft und eines Gerichtes müssen die gleichen Vorraussetzungen ( §§ 126 bis 129 BGB) erfüllen, wie alle anderen Dokumente und Urkunden einer Verwaltung auch. Mangelt es einer Urkunde nur an einer Formalie wie des fehlen einer Unterschrift des zuständigen Richters/Staatsanwaltes, eines Beglaubigungsvermerkes des Urkundsbeamten oder eines Dienstsiegels, so sind diese von Anfang an nichtig („ex tunc“), und zwar unabhängig vom Willen der Beteiligten, wirkt gegen jedermann, kann keine Rechtswirkung und Fristen erzeugen, ist keinem Rechtsmittel unterworfen, denn ihre Nichtigkeit steht per Rechtsbefehl fest (§ 125 BGB).
Die Eröffnungsentscheidung ist keine bloße Formalie, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Zwischenverfahrens [vgl. §§ 199 bis 211 StPO]. Dieses wird eingeleitet von der Staatsanwaltschaft durch Erhebung der öffentlichen Klage, und zwar in Form der Einreichung einer Anklageschrift beim zuständigen Gericht. Die abschließende Entscheidung des Gerichts, ob das Hauptverfahren eröffnet wird oder nicht, beendet das Zwischenverfahren.
Wegen der dargelegten grundlegenden Bedeutung für das gerichtliche Verfahren stellt der Erlass eines ordnungsgemäßen Eröffnungsbeschlusses eine Verfahrensvoraussetzung – genauer: eine Hauptverfahrensvoraussetzung – dar. Fehlt er oder ist er infolge von Mängeln zur Erfüllung der ihm zukommenden Funktion nicht geeignet und werden seine Mängel auch nicht (rechtzeitig) geheilt, so ist das Verfahren in jeder Lage von Amts wegen einzustellen [BGHSt 10, 137, 140; LR-Rieß a.a.O. § 207 Rn. 5 m.w.N.).
Einer Aufhebung eines angefochtenen Urteils und des erstinstanzlichen Urteils bedarf es nicht, weil die Einstellung des Verfahrens deren Wirkungen beseitigt [vgl. OLG Frankfurt NJW 1991, 2849, 2850; OLG Karlsruhe NStZ-RR 2003, 332].
Die §§ 125 bis 130 BGB sind wesentliche Prinzipien der rechtstaatlichen Ordnung. Formelle Beweiskraft aller Dokumente und Urkunden tritt erst ein, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform eingehalten und eine Legitimationsprüfung durch öffentliche Beglaubigung des Urkundsbeamten stattgefunden hat. Erst danach tritt Rechtskraft ein. Mangelt es gerichtlichen Urkunden an ihrer Rechtsfömlichkeit, so können sie keine Wirkung und damit keine Rechtskraft entfalten. „Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld als unschuldig.“ [vgl. Art. 48 Abs. 1 Grundrechtecharta der Europäischen Union.]
Die Unschuldsvermutung erfordert, daß der einer Straftat Verdächtigte oder Beschuldigte nicht seine Unschuld, sondern die Strafverfolgungsbehörde seine Schuld beweisen muß.
Zur Durchsetzung der Unschuldsvermutung sind strafrechtliche Verbote (Verfolgung Unschuldiger, falsche Verdächtigung, Verleumdung, üble Nachrede) und je nach Sachlage verschiedene zivilrechtliche Abwehr- und Ausgleichsansprüche (Anspruch auf Gegendarstellung, Widerruf, Richtigstellung, Schadensersatz, Geldentschädigung, Unterlassung) vorgesehen.
Die Vermutung der Unschuld endet mit der Rechtskraft der Verurteilung.
Vollstreckung gegen Unschuldige
Tatbestand der Vollstreckung gegen Unschuldige [Straftat nach § 345 StGB] ist das Vollstrecken einer Freiheitsstrafe, einer Maßregel der Sicherung und Besserung oder einer behördlichen Verwahrung (z. B. Ingewahrsamnahme nach den Polizeigesetzen der Länder), obwohl die Voraussetzungen für eine Vollstreckung nicht gegeben sind.
Zur tatsächlichen Freiheitsentziehung muss es (anders als bei der Freiheitsberaubung) noch nicht gekommen sein, vielmehr umfasst der Tatbestand jedes Handeln von der Anordnung der Vollstreckung über dessen Vollzug bis hin zur tatsächlichen Freiheitsentziehung und darüber hinaus noch die Überwachung der Dauer der Vollstreckung, soweit dieses Handeln zu einem nicht unerheblichen Nachteil für den Betroffenen geführt hat.
Verfolgung Unschuldiger
Die Verfolgung Unschuldiger ist gemäß § 344 des Strafgesetzbuches (StGB) ein Verbrechen, welches mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft wird. Die Tat gehört zu den echten Amtsdelikten. Denn wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren, abgesehen von dem Verfahren zur Anordnung einer nicht freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8), berufen ist, absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen oder jemanden, der sonst nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Satz 1 gilt sinngemäß für einen Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen Verwahrung berufen ist.
Untersuchungsgrundsatz
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
§ 24 Untersuchungsgrundsatz
(1) Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist sie nicht gebunden. Setzt die Behörde automatische Einrichtungen zum Erlass von Verwaltungsakten ein, muss sie für den Einzelfall bedeutsame tatsächliche Angaben des Beteiligten berücksichtigen, die im automatischen Verfahren nicht ermittelt würden.
(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.
(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält.
§ 86 VwGO
[Untersuchungsgrundsatz; Aufklärungspflicht; vorbereitende Schriftsätze]
(1) 1Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die Beteiligten sind dabei heranzuziehen. 2Es ist an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.
(2) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag kann nur durch einen Gerichtsbeschluß, der zu begründen ist, abgelehnt werden.
(3) Der Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, daß Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.
(4) 1Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Schriftsätze einreichen. 2Hierzu kann sie der Vorsitzende unter Fristsetzung auffordern. 3Die Schriftsätze sind den Beteiligten von Amts wegen zu übermitteln.
(5) 1Den Schriftsätzen sind die Urkunden oder elektronischen Dokumente, auf die Bezug genommen wird, in Abschrift ganz oder im Auszug beizufügen. 2Sind die Urkunden dem Gegner bereits bekannt oder sehr umfangreich, so genügt die genaue Bezeichnung mit dem Anerbieten, Einsicht bei Gericht zu gewähren.